Lieferung ab 30,00 Euro versandkostenfrei. Darunter nur 5,95 Euro.
Menü


Foto: OMG Snap - stock.adobe.com
Urban Mining betrachtet das anthropogene Lager, also den vom Menschen erschaffenen Bestand an Materialien. Der Kerngedanke hinter Urban Mining ist die Nutzung dieses anthropogenen Lagers als Rohstoffquelle. Da in den letzten Dekaden große Bestände an Material beispielsweise in Form von Infrastrukturen und Gebäuden sowie langlebigen Konsumgütern aufgebaut wurden, bietet dieses Lager ein großes Potenzial einer Sekundärrohstoffquelle. Urban Mining bezeichnet die Bewirtschaftung dieses anthropogenen Lagers, welches in seiner Definition einerseits sowohl genutzte als auch ungenutzte und andererseits sowohl mobile als auch stationäre Güter mit einschließt. An dieser Stelle wird deutlich, dass Urban Mining im Vergleich zur Recyclingwirtschaft eine andere Perspektive einnimmt und als Ergänzung der ursprünglichen Abfallwirtschaft betrachtet werden kann. Nicht das gesamte anthropogene Lager ist für eine Sekundärrohstoffwirtschaft relevant, unter anderem aus gesundheits- oder umweltschutzrelevanten Gründen beziehungsweise aufgrund möglicher Schadstoffe, die eine Weiternutzung der Ressourcen unmöglich machen (BMUV, 2020).
Das anthropogene Lager wird in verschiedenen Quellen unterschiedlich stark differenziert betrachtet. So unterscheidet das Umweltbundesamt beispielsweise fünf (langlebige) Gütergruppen: Gebäude, leitungsgebundene Infrastrukturen, Haustechnik und langlebige Kapital- und Konsumgüter (UBA, 2017).





Das anthropogene Lager in Deutschland umfasst große Materialmengen und wächst weiterhin an. Bereits vor fünf Jahren umfasste es 342 Tonnen Material pro Kopf und es ist davon auszugehen, dass die Menge in den letzten Jahren weiter zugenommen hat (UBA, 2017). Zusammengesetzt sind sie zu einem Großteil aus mineralischen Materialien (317 Millionen Tonnen) gefolgt von Metallen mit einer deutlich geringeren Menge von 14 Tonnen (UBA, 2017). Das anthropogene Lager in Deutschland entsprach im Jahr 2010 in etwa der Summe aller Rohstoffe, die weltweit im Jahr 2000 abgebaut wurde und über 80 Prozent davon sind auf den Zuwachs des Lagers seit 1960 zurückzuführen (BMUV, 2020).
Es wird deutlich, dass das Lager der langlebigen Konsumgüter massebezogen einen sehr kleinen Anteil am Gesamtlager ausmacht. Seine Relevanz ergibt sich jedoch aus den eingesetzten Materialien, das heißt den hohen Anteilen an verbauten Metallen, die für eine erneute Verwendung besonders relevant sind.
Deutlich wird dies durch den Wert der eingesetzten Rohmaterialien, der zum Zeitpunkt der letzten Kartierung für das gesamte Lager auf 1300 Milliarden Euro geschätzt wurde, wobei Metalle 50 Prozent dieses Werts ausmachen (UBA, 2017). Der Wert der im globalen Elektroschrott enthaltenen Rohstoffe für das Jahr 2019 zeigt, dass Eisen, Kupfer und Gold die höchsten Werte aufweisen. Die entsprechenden Werte für die anderen Materialien sind trotz ihres deutlich höheren Volumens aufgrund der niedrigeren Rohstoffpreise geringer.
Für einige Rohstoffe sind die anthropogenen Lager inzwischen auf eine signifikante Größenordnung gegenüber den geologischen Ressourcen angewachsen. So wurden die weltweiten anthropogenen Ressourcen von Kupfer bei der letzten Kartierung im Jahr 2010 beispielsweise auf bis zu 400 Millionen Tonnen geschätzt, was knapp 60 Prozent der geologischen Reserven für Kupfer und knapp 20 Prozent der Kupferressourcen entspricht (UBA, 2017). Schreibt man die Entwicklung der letzten Jahre fort, so ist davon auszugehen, dass die geologischen Vorräte durch Extraktion weiter abgenommen haben und das anthropogene Lager währenddessen weitergewachsen ist.
Die Kreislaufwirtschaft und das Urban Mining haben nicht immer die gleichen Zielsetzungen. Maßnahmen zur Ressourceneffizienz im Rahmen der Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft sind ein Beispiel. Sie erfordern, Produkte mit weniger, umweltschonenderen oder leichter verfügbaren Rohstoffen herzustellen, wodurch Geräte kleiner geworden sind und teure Metalle durch andere Materialien ersetzt wurden. Diese Entwicklung verringert die potenziellen Einnahmen aus dem Recycling, während der Aufwand für die Materialtrennung aufgrund der geringen Größe der Geräte steigt (Fraunhofer ISI, 2020). Die Nutzung urbaner Minen kann Materialkosten im Produzierenden Gewerbe senken und die inländische Wertschöpfung steigern, weshalb auch ökonomische Gründe für Urban Mining sprechen können. Die Vorteile von Urban Mining liegen auf der Hand. Das anthropogene Lager kann einfach gefunden und ausgeschöpft werden, während man die geologisch zu gewinnenden Rohstoffe zumeist aufwändig abbauen muss. Der Wertstoffgehalt von Metallen ist im anthropogenen Lager deutlich höher, da er dort oft in Reinform oder hochlegiert verarbeitet ist. Ein Beispiel sind Kupferleitungen, von denen ein Meter aus dem Informations- und Kommunikationsbereich genauso viel Metall beinhalten, wie 2,5 Tonnen Erz, aus dem der Rohstoff Kupfer gewonnen wird (acatech, 2021). Nachteil an dieser Stelle sind die möglicherweise kostenintensiven Prozesse, die notwendig sind, um die Materialverbünde aufzubereiten. Für Urban Mining sprechen kürzere Transportwege, die großflächige Verteilung macht es an manchen Stellen wieder kostenintensiver.
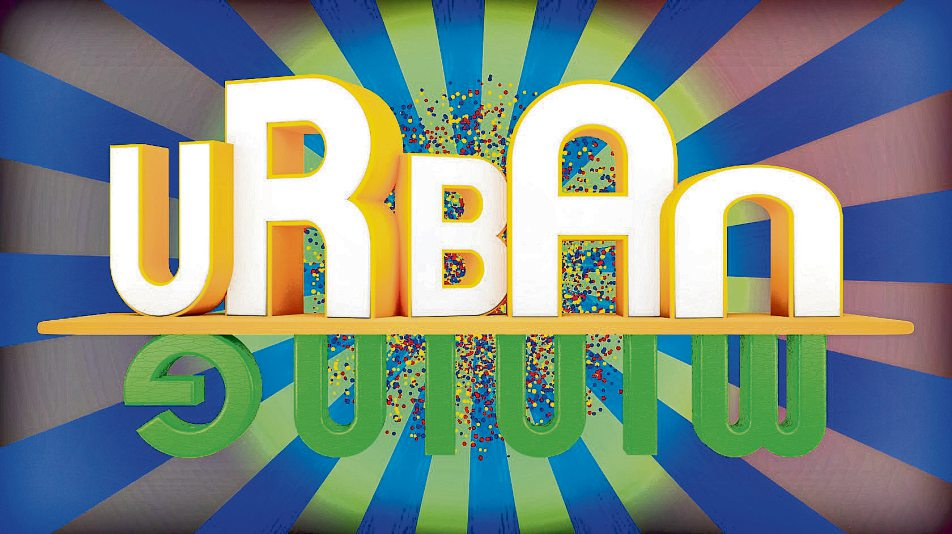
Als eine der plakativsten „urbanen Minen“ gelten Smartphones. In ihnen sind wertvolle Rohstoffe enthalten, die durch hohen Materialwert und gute Recyclingeigenschaften eine gute Basis als urbane Minen bieten. Hier ist der Zeitpunkt, an dem man das Produkt zur Rückgewinnung der Rohstoffe erhalten kann, wichtig, denn oftmals werden noch funktionsfähige Geräte in der Schublade als Reserve aufgehoben, obwohl man sie schon längst als Rohstoffquelle nutzen könnte. Diese Smartphones bieten eine wichtige Rohstoffquelle, denn sie bestehen zu 45 Gewichtsprozent aus Metallen, gefolgt von Glas, Kunststoffen und Materialverbunden und wiegen durchschnittlich 110 Gramm. Dies geht aus einer Analyse der deutschen Rohstoffagentur (DERA) und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hervor, die drei repräsentative Smartphone-Modelle des Zeitraums 2012 bis 2017 untersucht haben (Bookhagen/Bastian, 2020). Die häufigsten Metalle sind Eisen, Silizium, Magnesium, Aluminium, Kupfer, Nickel, und Chrom. Zusammen mit Zinn, Zink und Strontium summiert sich ihre Masse auf 93 Gewichtsprozent der gesamten Metalle im Smartphone. Obwohl der Goldanteil eines Smartphones beispielsweise nur durchschnittlich 0,017 Gramm entspricht, macht es etwa 65 Prozent des gesamten Metallwerts aus. Hochgerechnet auf die 210 Millionen sogenannten Schubladenhandys in Deutschland, liegen entsprechend etwa 3356 Tonnen Eisen, 1520 Tonnen Magnesium, 1388 Tonnen Kupfer, 1403 Tonnen Aluminium, 3,57 Tonnen Gold und 1947 Tonnen Silizium ungenutzt in Haushalten.
Aber auch die Konflikte des Urban Minings lassen sich hier gut abbilden: Der Edelmetallgehalt der Leiterplatten ist im Zeitraum zwischen 2012 und 2017 erheblich gesunken (40 Prozent bei Gold, 30 Prozent bei Palladium und 70 Prozent bei Silber) bei gleichzeitiger Steigerung der Leistung (Bookhagen et al., 2020). Die Folge ist ein sinkender Materialwert pro Einheit und damit eine Reduzierung der Rentabilität eines späteren Recyclings (Fraunhofer ISI, 2020). Dieser Zusammenhang betont die Wichtigkeit, zirkuläre Strategien ganzheitlich zu begreifen und Urban Mining als ein Teilaspekt einer Kreislaufwirtschaft zu betrachten, in der es wesentliche Strategien zur Verlängerung, Ermöglichung und Schaffung von Kreisläufen gibt. Eine Kreislaufführung für nicht mehr genutzte Smartphones und die Nutzung dieser inländischen Urbanen Mine zur Rückgewinnung von Metallen macht insbesondere vor dem Hintergrund Sinn, dass einige der Metalle, die in Smartphones verbaut sind, als kritisch einzustufen sind und aus wenigen Importländern stammen. Zusätzlich dazu, führt die Ausnutzung dieser urbanen Mine vor allem in Kombination mit der Nutzung anderer Elektro- und Elektronikgeräte zu deutlich höheren Mengen potenzieller Sekundärrohstoffe. Obwohl der Materialwert aller Schubladenhandys sehr hoch ist und sich die Nutzung dieser Urbanen Mine insbesondere für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland lohnen kann, erscheint der Materialwert eines einzelnen Geräts mit 1,15 Euro eher niedrig. Daher ist die Erkenntnis wichtig, dass der Materialwert von Produkten in der Regel (deutlich) geringer ist als der Wert der Produkte selbst. Herausforderungen beim Recycling von Smartphones bestehen im Wesentlichen in den Trenn- und Sortierverfahren und den Recyclingtechnologien. Insbesondere die Wirtschaftlichkeit der Prozesse spielt aufgrund des geringen Metallwertes in den Produkten eine wichtige Rolle. Zudem muss das Recycling auch ökologisch sinnvoll sein, wozu der hohe Energieaufwand zu beachten und gegebenenfalls zu optimieren ist (Bookhagen/Bastian, 2020). Sarah Fluchs/ Adriana Neligan IW Köln