Lieferung ab 30,00 Euro versandkostenfrei. Darunter nur 5,95 Euro.
Menü


Die Änderungen im Berufsbildungsgesetz müssen Eingang in die neuen Ausbildungsverträge finden. Foto: ©Stockfotos-MG - stock.adobe.com
Seit dem 1. Januar 2020 ist die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes in Kraft. Das hat auch Auswirkungen auf den Ausbildungsvertrag, der vor Beginn der Lehre zwischen Azubi und Ausbildungsbetrieb geschlossen wird. Wir schauen uns an, was in einem Ausbildungsvertrag so alles geregelt ist.
In einem Ausbildungsvertrag sollten sowohl Art als auch sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung gefasst sein. Das bedeutet, er gibt Auskunft über Beginn und Dauer der Ausbildung, die Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte (Schule und vorgeschriebene Ausbildungsbestandteile, die nicht im Betrieb absolviert werden können) und die Dauer der täglichen Ausbildungszeit. Ebenso sollte er Angaben über die Dauer der Probezeit, die Anzahl der Urlaubstage und Informationen über die Ausbildungsvergütung enthalten. Last but not least enthält ein Ausbildungsvertrag Angaben zur Kündigung des Berufsausbildungsvertrages sowie Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf den Vertrag wirken können.
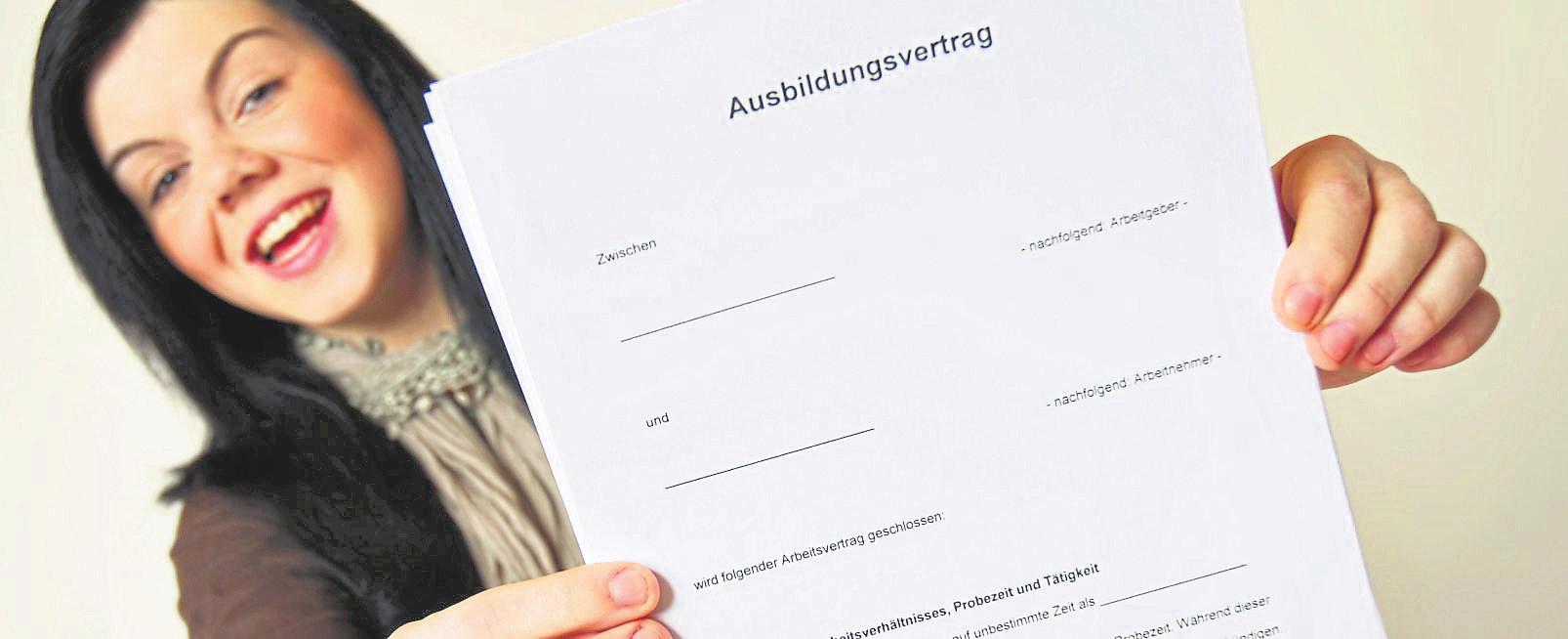
Auszubildende haben viele Rechte, aber genauso auch Pflichten, denen sie nachkommen müssen. So gehört dazu, dass Azubis nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht dazu haben, zu lernen und sich bemühen müssen, Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben, die zur Erlangung des Ausbildungszieles notwendig sind. Bei allem ist der Auszubildende verpflichtet, den Anweisungen des Ausbilders zu folgen und ein Berichtsheft zu führen, welches der Ausbilder regelmäßig sehen und gegebenenfalls unterzeichnen sollte. Zu den Pflichten eines Azubis gehört der Besuch in der Berufsschule ebenso wie die Teilnahme an sonstigen Ausbildungsmaßnahmen und vor allem: Prüfungen.
Material und Maschinen, die täglich zum Einsatz kommen, sind Eigentum des ausbildenden Unternehmens. Das bedeutet, sie sind pfleglich zu behandeln und können auch nicht einfach ausgeliehen werden. Genau wie Maschinen und Material haben auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse in der Firma zu verbleiben und dürfen nicht nach außen getragen werden.
Die Ausbildung beginnt in der Regel mit einer Probezeit, die mindestens einen und höchstens vier Monate dauern kann. Innerhalb dieser Zeit können Azubi und Ausbildungsbetrieb testen, ob sie zueinander passen und ob die Berufswahl die Richtige war. Insgesamt dauert eine Ausbildung drei bis dreieinhalb Jahre.
Diese Zeit kann verkürzt werden, wenn man bereits ein Berufsgrundbildungsjahr oder eine Berufsfachschule erfolgreich besucht hat, oder eine höhere schulische Ausbildung vorweisen kann.
Auszubildende, die noch nicht volljährig sind, dürfen täglich nicht länger als acht Stunden und wöchentlich nicht länger als 40 Stunden arbeiten. Arbeitsbeginn darf nicht vor sechs Uhr sein, Ausnahmen bilden hier nur Bäckereien, Konditoreien oder die Landwirtschaft. Später als 20 Uhr dürfen Azubis unter 18 nicht arbeiten und auch an Wochenenden gibt es nur wenige Ausnahmen vom Arbeitsverbot. Anders sieht es für Azubis über 18 Jahre aus. Für sie darf eine Arbeitswoche schon mal 48 Stunden haben und kann in Ausnahmefällen auch schon mal auf zehn Stunden täglich verlängert werden. An Wochenenden ist die Arbeit auch für volljährige Azubis untersagt.
Der Berufsschulunterricht ist fester Bestandteil der Ausbildung und der Auszubildende wird für diese Zeit von der Arbeit freigestellt. Beginntdie Schule vor 9 Uhr, muss der Azubi vorher nicht mehr im Ausbildungsbetrieb erscheinen, auch wenn der Unterricht fünf Unterrichtsstunden von mindestens 45 Minuten umfasst. Bei Blockunterricht an mindestens fünf Tagen mit insgesamt mindestens 25 Stunden ist der Azubi ebenfalls nicht mehr verpflichtet, in den Ausbildungsbetrieb zu gehen. Neu ist, dass erwachsene Auszubildende ihren jugendlichen Kolleg*innen gleichgestellt werden. Alle Auszubildende haben Anspruch auf einen freien Arbeitstag unmittelbar vor der Prüfung.
Die Urlaubszeit ist ebenfalls im Ausbildungsvertrag geregelt. Nach sechs Monaten Arbeitszeit erwerben Auszubildende ihren vollen Urlaubsanspruch. Jugendliche Auszubildende haben einen Urlaubsanspruch von 30 Werktagen, wenn sie zu Beginn des Kalenderjahres noch keine 16 Jahre als sind, 27 Werktage, wenn sie noch keine 17 Jahre alt sind und mindestens 25 Tage, wenn sie zu Beginn des Kalenderjahres noch keine 18 Jahre alt sind. Hier lohnt sich genaues Hinsehen sicherlich.
Die Ausbildungsvergütung wird für alle Ausbildungsphasen im Vertrag festgelegt. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Höhe häufig an bestehenden Tarifverträgen orientiert und festgelegt sind. Auch für Unternehmen ohne tarifliche Bindung sind diese Beträge durchaus als Orientierung zu sehen, denn sie dürfen geltende Tarife nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten. Für Ausbildungsverträge, die nach dem 1. Januar 2020 geschlossen wurden, gilt zudem, dass auch für tarifungebundene Unternehmen gilt, dass sie eine Mindestausbildungsvergütung zahlen müssen, es sei denn, die tariflichen Vereinbarungen sehen eine Vergütung unterhalb des Mindestsatzes vor.