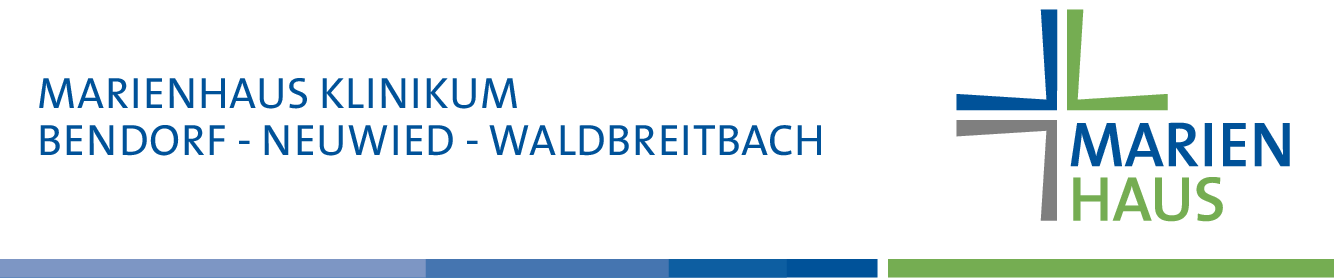Lieferung ab 30,00 Euro versandkostenfrei. Darunter nur 5,95 Euro.
Menü


Fast vier Millionen Menschen leiden allein in Deutschland an einer Herzinsuffizienz. Damit zählt die Herzschwäche zu den sogenannten Volkskrankheiten und ist eine der häufigsten Todesursachen. „Wichtig ist eine frühzeitige Diagnose und Behandlung“, betont Dr. Burkhard Hügl, der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin-Kardiologie/Rhythmologie am Marienhaus Klinikum St. Elisabeth. Denn eine Herzinsuffizienz ist eine bedrohliche chronische Erkrankung, bei der der Herzmuskel geschwächt ist. Deshalb ist er nicht mehr in der Lage, ausreichend sauerstoffreiches Blut in den Körper zu pumpen. Betroffene geraten oft schon bei kleinen körperlichen Anstrengungen, wie Treppensteigen, außer Atem und verspüren Luftnot. Zudem können sich Wasseransammlungen in der Lunge und Ödeme bilden.
Die Beschwerden beginnen jedoch oft schleichend. Viele Patientinnen und Patienten bemerken sie deshalb zunächst nicht oder schieben sie auf ihr Alter. Das sei jedoch ein großer Fehler, denn unbehandelt schreitet die Herzerkrankung fort. „Die Patienten brauchen eine regelmäßige medizinische Betreuung“, sagt Dr. Hügl. Die Herzschwäche sei vergleichbar mit anderen chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel dem Diabetes.
Speziell für Patienten mit Herzschwäche gibt es am Marienhaus Klinikum St. Elisabeth eine sogenannte Herzinsuffizienzeinheit. Hier betreut ein Team aus Kardiologinnen und Kardiologen sowie speziell ausgebildeten Pflegekräften die Betroffenen während ihres Aufenthaltes. Sie erhalten hier zunächst eine gründliche Diagnose. Denn für die qualifizierte Behandlung ist es wichtig, die Ursache der Herzschwäche zu kennen.
In vielen Fällen ist die Herzschwäche eine Folge eines Herzinfarkts. Dabei werden Teile des Herzmuskels aufgrund einer Durchblutungsstörung in den Herzkranzgefäßen schwer geschädigt oder sterben sogar ab. „Diese Bereiche können sich dann nicht mehr zusammenziehen und beeinträchtigen langfristig die Pumpleistung“, so Dr. Hügl. Deshalb müssen Patienten, die einen Herzinfarkt erlitten haben, schnellst möglich in einem Herzkatheterlabor behandelt werden. „Hier öffnen wir die verstopften Herzkranzgefäße und sorgen dafür, dass das Herz wieder mit sauerstoffreichem Blut versorgt wird“, erklärt Dr. Hügl. Das Herzkatheterlabor am Marienhaus Klinikum St. Elisabeth hat rund um die Uhr jeden Tag im Jahr geöffnet.
Eine Herzinsuffizienz kann jedoch auch in Folge einer koronaren Herzkrankheit entstehen, bei der sich durch Ablagerungen Engstellen in den Herzkrankgefäßen bilden. Eine Kardiomyopathie, also eine Erkrankung des Herzmuskels, kann ebenfalls die Pumpleistung des Herzens reduzieren und eine Herzinsuffizienz bewirken. Kardiomyopathien werden vererbt oder können durch eine Herzmuskelentzündung entstehen. Weitere Gründe für eine Herzinsuffizienz sind zum Beispiel ein unbehandelter Bluthochdruck, aber auch Herzrhythmusstörungen. Entzündungen der Herzklappen und Herzklappenfehler belasten ebenfalls das Herz.
Während ihres Aufenthaltes in der Herzinsuffizienz-Einheit wird die Herztätigkeit der Patienten rund um die Uhr mit einem Monitor überwacht. Nach der Diagnostik werden sie je nach Befund therapiert. Leidet der Patient beispielsweise an Rhythmusstörungen, dann können diese mit Hilfe einer Ablation im Herzkatheterlabor behandelt werden. Auch Herzklappenfehler, werden im Herzkatheterlabor therapiert. Zusätzlich werden die Betroffenen medikamentös optimal eingestellt. „Es gibt inzwischen zahlreiche Medikamente, mit denen wir den Patienten gut helfen und die Sterblichkeitsrate deutlich senken können“, so Dr. Hügl. Daneben werden bei manchen Patienten spezielle Herzschrittmacher-Systeme implantiert, um die Pumpleistung des Herzens zu verbessern. Ihr Herz wird so stabilisiert und die Lebensqualität des Patienten entscheidend verbessert.
Entscheidend sei aber, dass die Betroffenen ihre verordneten Arzneimittel regelmäßig einnehmen. Dabei unterstützt sie eine eigens ausgebildete Krankenschwester. Sie ist dafür freigestellt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Programms telefonisch zu begleiten. „Durch diesen Telefonservice können wir die Herzleistung der Patienten stabilisieren und sie davor bewahren, immer wieder ins Krankenhaus eingeliefert zu werden“, freut sich Dr. Hügl. „Wir sehen dieses Angebot als Bindeglied zwischen der stationären Behandlung im Krankenhaus und der ambulanten Therapie beim niedergelassenen Kardiologen oder Hausarzt“. Zahlreiche Patienten nehmen diese zusätzliche Begleitung sehr gerne an. Sie sind dankbar für die Unterstützung, denn sie spüren, dass es ihnen damit viel besser geht.
Sekretariat für Innere Medizin Kardiologie/Rhythmologie
Heike Klein
Telefon 02631 82-1212
Heike.klein@marienhaus.de
Silke Schüller
Telefon 02631 82-1515
Silke.schueller@marienhaus.de
Stationärer Bereich
Station 21 - Silke Flick
Telefon 02631 82-1222
Nachsorge - Telemonitoring
Daniela Hammes-Kaul
Telefon 02631 82-1650
hfu.telemonitoring@marienhaus.de
24-Stunden-Notfalltelefon für Patienten
02631 82-2070